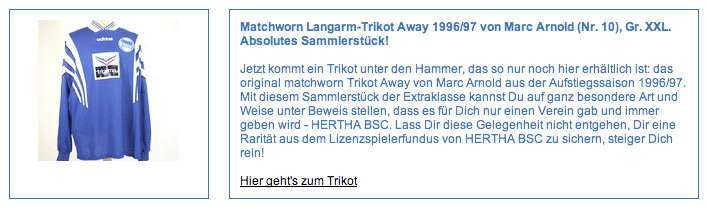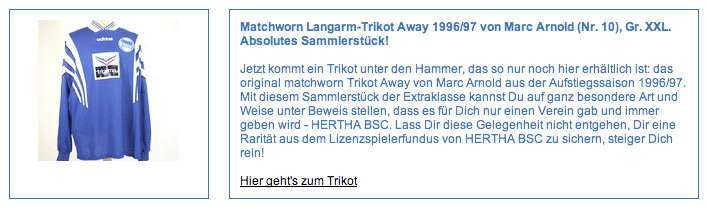Es wird in dieser Saison mit Sicherheit Mannschaften geben, gegen die Hertha BSC auf Offensive verzichten und hinten dicht machen muss. Der 1. FC Nürnberg zählt aber definitiv nicht dazu.
Was hatte der Herthatrainer dann aber für einen Grund, eine Mannschaft auflaufen zu lassen, in der kreative Spieler maximal auf der Außenbahn zu finden waren, in der kein offensives Mittelfeld vorhanden war und die Anweisung an jeden einzelnen Spieler wohl allein aus dem Wort „Verteidigen!“ bestand?
Und die für mich entscheidendere Frage: Warum leistet es sich Markus Babbel, mit Raffael und Fabian Lustenberger zwei Spieler, denen der Siegeswille aus jeder Pore kocht, nicht nur auf die Bank zu setzen, sondern -laut Presseberichten- auch noch schlecht zu reden? Das Einzige, was man diesen Spielern vielleicht vorwerfen kann, ist, dass sie auf dem Platz deutlich ruhiger als manch anderer Spieler sind. Da ich auf dem Fußballplatz aber ähnlich bin (von der Lautstärke und der Einstellung, fußballerisch fehlt’s leider bei mir), weiß ich, dass das eine mit dem anderen wenig zu tun hat. Und ich glaube auch, dass man ohne viele Worte, seine Kameraden mitreißen kann. Auch wenn jemand in der Mannschaft, der auch mal das Maul aufreißt, nie verkehrt ist.
Wenn man nach zwei Saisonspielen also schon Schlüsse ziehen kann, dann ist dies meiner: das vielbeschworene „Bayern-Gen“ hat nichts mit Leidenschaft zu tun. Die Spieler, denen dieses nachgesagt wird, waren nicht in der Lage, positive Einflüsse auf die Mannschaft auszuüben. Auch Peter Niemeyer ist für mich mit seinem Einsatzwillen, aber den eingeschränkten Möglichkeiten das Spiel zu eröffnen, eher ein Innenverteidiger als ein Sechser. Und für einen Abwehrspieler wiederum wäre seine Spieleröffnung sehr gut.
Ein anderer Abwehrmann hat mir in einer Szene gestern gut gefallen: Maik Franz löste sich aus dem Abwehrverband, marschierte mit Tempo und Ball nach vorn, wurde aber nachdem er abgespielt hatte, auf der rechten Seite von den Mitspielern leider übersehen. Schade, dass dies eine einmalige Aktion blieb, gegen die schwachen Nürnberger, wäre mit viel mehr Offensivdrang auf jeden Fall mehr drin gewesen.
Zurück zu den Sechsern: wenn ich Niemeyer also in die Abwehr an die Seite von Maik Franz verbanne, wird Platz für Fabian Lustenberger. Sollten dessen Rückstand nach der U21-EM tatsächlich vorhanden sein, wäre er zumindest für die Zeit, die er durchhält, die erste Wahl. Und der zweite Sechser? Wird abgeschafft. Mit Raffael haben wir schließlich einen Spieler, der in der letzten Saison bewiesen hat, dass er sowohl zurückgezogen als auch hinter den Spitzen enormes Potential hat und es jedem Gegner schwer machen kann.
Raffael und Lusti vereinigen beide die Art von Einsatzwillen und Spielkultur in sich, die Hertha in dieser Zeit dringend braucht. Überrascht war ich dann heute Morgen, dass diese beiden auch im Morgenpost-Blog herausgehoben wurden. Und es war mir eine Freude bei der Umfrage „Was soll Hertha nach dem 0:1 gegen Nürnberg machen?“ für die Option Raffael und Lustenberger gehören in die Startelf abzustimmen (die derzeit übrigens mit 60% der Stimmen ganz vorn liegt).
Bleibt zu hoffen, dass Markus Babbel nicht wie Lucien Favre aus persönlichen Motiven auf den maximalen Erfolg der Mannschaft verzichtet. Denn je früher der Klassenerhalt gesichert wird, desto besser!
Update: leider bin ich eben erst auf Daniels Artikel aufmerksam geworden. Seine Zusammenfassung der falschen Einstellung mancher Spieler lässt meine vage Kritik am Bayern-Gen für mich klarer werden. Vielleicht können sich insbesondere die Neuverpflichtungen tatsächlich nicht mit dem Abstiegskampf anfreunden, denn das Gen ist ja auf maximalen Erfolg ausgerichtet…